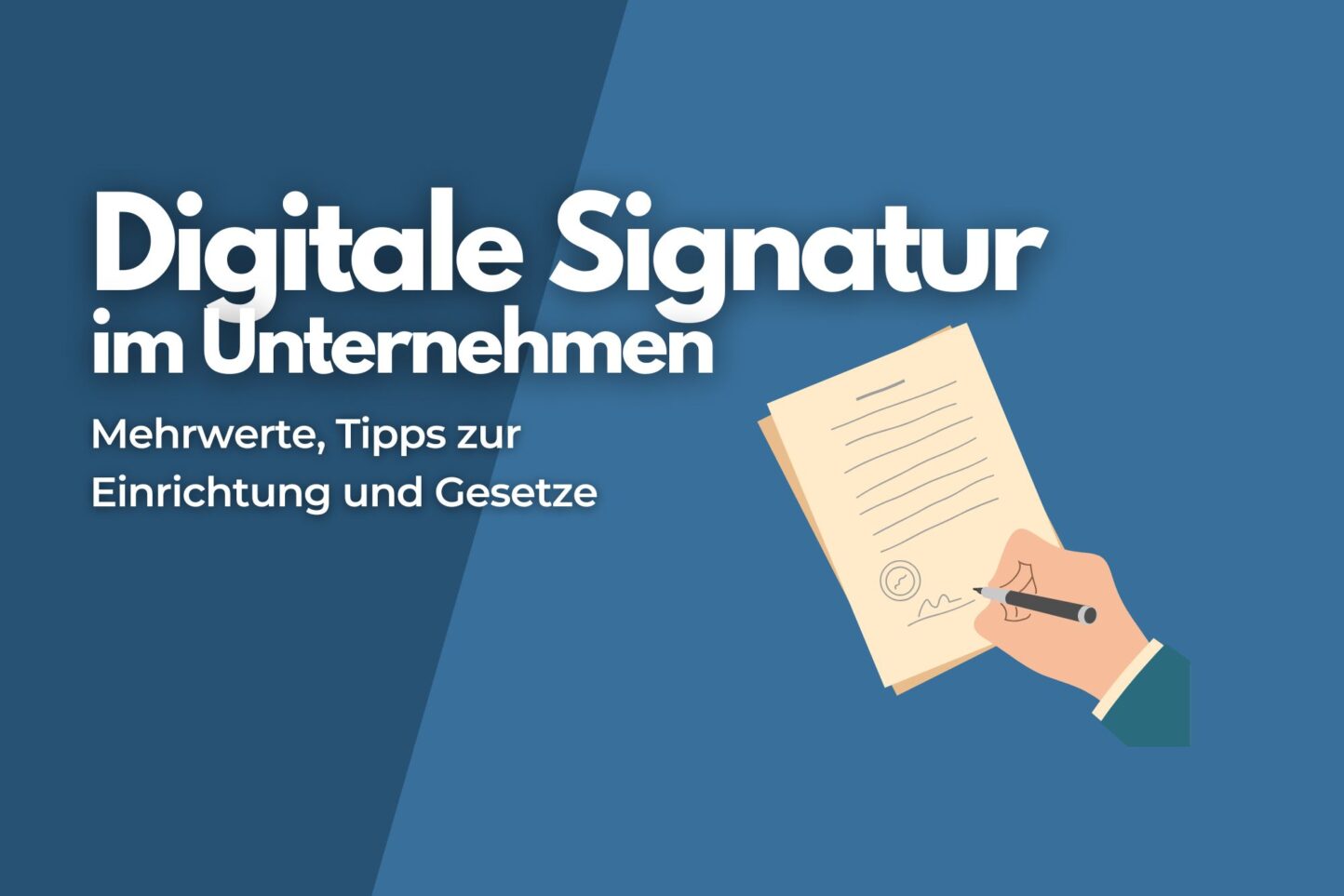
Digitale Signaturen: Mehrwerte, Tipps zur Einrichtung und gesetzliche Vorgaben
Statt wie vor Jahren Verträge oder wichtige Dokumente per Post zur Unterschrift zu versenden, kann mit einer digitalen Signatur ein Dokument in wenigen Sekunden rechtssicher signiert und an den Empfänger übermittelt werden. Die digitale Unterschrift spart Zeit, Kosten und ist effizient. Sie hat sich in vielen Geschäftsvorgängen in Unternehmen inzwischen als unverzichtbarer Standard etabliert.
Dieser Artikel bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über die Welt der digitalen Signaturen. Er erklärt leicht verständlich und praxisnah, wie digitale Signaturen funktionieren und auf welchen technologischen Grundlagen sie aufbauen. Sie erfahren sowohl, wie die Verschlüsselung funktioniert und wie Sie sich mit digitalen Signaturen rechtskonform authentifizieren.
Außerdem geht der Artikel darauf ein, welche Vorteile digitale Signaturen Ihrem Unternehmen in Bezug auf Schnelligkeit, Kostenersparnis, Umweltschutz und Rechtssicherheit bringen. Darüber hinaus beleuchtet die Abhandlung die rechtlichen Grundlagen, die für digitale Signaturen in Deutschland und der EU gelten, einschließlich der eIDAS-Verordnung.
Was ist eine digitale Signatur?
Als digitale Signatur, die in vielen Fällen auch als elektronische Signatur bezeichnet wird, versteht man eine methodische Verschlüsselung. Mit der digitalen Signatur ist es möglich, elektronische Dokumente rechtlich verbindlich zu unterschreiben und die Identität sicherzustellen. Die elektronische Signatur ersetzt die klassische handschriftliche Unterschrift. Sie ist in den meisten Fällen genauso rechtsgültig wie die handschriftliche Unterschrift. Die Rechtsgültigkeit wird durch internationale oder nationale Gesetzen, beispielsweise die europäische eIDAS-Verordnung sichergestellt.
Moderne Algorithmen gewährleisten die Integrität aller elektronisch signierten Dokumente. Es kann digital eindeutig nachgewiesen werden, dass ein Dokument nach der Unterzeichnung nicht manipuliert wurde. Gleichzeitig bestätigt die digitale Signatur die Authentizität der Identität der unterzeichnenden Personen. Dies geschieht vor allem durch digitale Zertifikate und eine Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Digitale Signaturen haben sie weitläufig im Geschäftsumfeld durchgesetzt. Sie finden Anwendung bei Vertragsabschlüssen im B2B und B2C-Umfeld, bei Einstellungen und Arbeitsverträgen, bei behördlichen Dokumenten oder im Geschäftsverkehr, wo Effizienz, Sicherheit und Nachverfolgbarkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Warum elektronische Signaturen rechtssicher sind
Für Deutschland und die Europäische Union bietet die EU-Verordnung eIDAS, die 2016 vollständig in Kraft getreten ist, den Rahmen der Rechtsgültigkeit. Grundsätzlich werden digitale Signaturen in drei Kategorien unterteilt, die jeweils unterschiedliche Sicherheitsniveaus und Anwendungsmöglichkeiten bieten:
Einfache elektronische Signatur
Eine einfache elektronische Signatur besteht in der Regel aus einer eingescannten Unterschrift oder einem Häkchen in einem Online-Formular. Sie ist leicht anzuwenden. Allerdings bietet sie Unternehmen bei Vertragsabschlüssen nur eine geringe Beweiskraft, da sie nicht eindeutig einer bestimmten Person zugeordnet werden kann. Die einfache elektronische Signatur eignet sich aus diesem Grund vor allem für informelle Vereinbarungen oder Fälle, bei denen keine rechtlich bindende Absicherung erforderlich ist.
Fortgeschrittene elektronische Signatur
Die fortgeschrittene elektronische Signatur stellt im Gegensatz eine sicherere Methode der digitalen Unterschrift dar. Durch diese Art der Unterschrift wird eine eindeutige Zuordnung der Identität einer Person ermöglicht. Dies wird unter anderem durch spezielle Verschlüsselungstechnologien und eine Identitätsprüfung des Unterzeichners gewährleistet.
Die elektronische Unterschrift ist fälschungssicherer und bietet ein höheres Maß an Beweiskraft. Diese Mehrwerte machen die fortgeschrittene elektronische Signatur ideal für Geschäftsverträge oder sensible Dokumente, bei denen die Identität der Vertragspartner klar nachweisbar sein müssen.
Qualifizierte elektronische Signatur (QES):
Die qualifizierte elektronische Signatur erfüllt die höchsten rechtlichen und sicherheitstechnischen Standards. Sie ist die einzige digitale Signatur, die die gesetzlich vorgegebene Schriftform vollständig ersetzen kann.
Qualifizierte elektronische Signaturen werden in Deutschland durch Anbieter vergeben, die von der Bundesnetzagentur und dem BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) zertifiziert sind. Durch die Nutzung eines sicheren Signaturerstellungssystems und einer eindeutigen Identitätsprüfung, beispielsweise durch Video-Ident-Verfahren oder persönliche Identifikation, wird ein Höchstmaß an Sicherheit garantiert.
Die qualifizierte elektronische Signatur wird in Deutschland besonders im Finanz-, Rechts- oder Gesundheitswesen eingesetzt. Dies ist nachvollziehbar, da in diesen Branchen besonders strenge gesetzliche Anforderungen zur Dokumentensicherheit und zum Datenschutz gelten. Qualifizierte, elektronische Signaturen sind ein Schlüsselelement für die proaktive Digitalisierung von Prozessen. Sie ermöglichen es Unternehmen, effizient und rechtssicher zu arbeiten.
Insgesamt bietet die eIDAS-Verordnung den rechtlichen Rahmen, um elektronische Signaturen innerhalb der EU einheitlich und länderübergreifend einzusetzen, was den Geschäftsverkehr in der digitalen Welt erheblich erleichtert.
Digitale Unterschrift: Vorteile für Unternehmen
Digitale Signaturen bieten Unternehmen eine Vielzahl von Vorteilen:
- Zeiteinsparung: Verträge und Dokumente können in Sekunden statt Tagen unterzeichnet werden.
- Kostenreduktion: Einsparungen durch weniger Papierverbrauch, Druck- und Versandkosten sowie die Nachverfolgung von Unterschriften und die manuelle Ablage können großen Unternehmen ein hohes Einsparpotenzial bieten.
- Ortsunabhängigkeit: Die digitale Unterschrift kann weltweit erfolgen, ob im Büro, zuhause oder unterwegs auf einer Geschäftsreise. Sie kann in Sekunden weiterverarbeitet werden.
- Einfache Nachverfolgbarkeit: Status und Historie eines Dokuments sowie die Identität des Unterzeichners sind digital nachvollziehbar.
- Sicherheit: Durch den Einsatz kryptografischer Techniken werden Inhalte gegen Manipulation geschützt. Bei der asymmetrischen Kryptografie verwendet man zwei Schlüssel. Der geheime Schlüssel wird genutzt, um den Vertrag oder das Dokument zu unterschreiben. Der öffentliche Schlüssel dient dazu, dass andere die Unterschrift prüfen können. Hash-Funktionen erstellen aus einem Dokument eine einzigartige Prüfsumme, die sich bei kleinsten Änderungen am Dokument vollständig verändert.
Gesetzliche Grundlage in der EU und Deutschland
Die europäische eIDAS-Verordnung schafft einen einheitlichen Rechtsrahmen für elektronische Signaturen in der EU. Sie ersetzt ehemalige nationale Vorschriften, wie das frühere deutsche Signaturgesetz. Zudem regelt die EU-Verordnung die Anerkennung von Vertrauensdiensten und Signaturanbietern und ermöglicht ein grenzüberschreitendes Signieren innerhalb der EU.
Die Rechtsgültigkeit von Signaturen wird anhand der Signaturstufe bewertet. Während einfache und fortgeschrittene Signaturen für viele Geschäftsvorgänge ausreichen, ist für Dokumente mit gesetzlicher Schriftform, wie Kündigungen, die qualifizierte elektronische Signatur Pflicht.
Nationale Vorschrift: Das Vertrauensdienstegesetz
Das Vertrauensdienstegesetz (VDG) setzt die europäische eIDAS-Verordnung in deutsches Recht um. Ein nationales Gesetz ist notwendig, um die regionalen Zuständigkeiten und Aufsichtsstrukturen für Vertrauensdienste festzulegen. Das Vertrauensdienstegesetz regelt darüber hinaus die Mitwirkungspflichten der Anbieter, die Zertifizierung und Überwachung durch die Bundesnetzagentur sowie Haftungsfragen und Fragen des Datenschutzes. Das VDG konkretisiert die Vorgaben von eIDAS an Punkten, an denen nationale Präzisierungen erforderlich sind.
Einschränkungen der digitalen Signatur
Nicht jedes Dokument darf rein digital signiert werden. Beispielsweise sind folgende Verträge und Dokumente von der elektronischen Signatur ausgeschlossen:
- Kündigungen von Arbeitsverträgen: Der § 623 BGB sagt eindeutig: „Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch Kündigung oder Auflösungsvertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen.“
- Mietverträge mit einer Laufzeit über einem Jahr (§ 550 BGB).
- Eigenhändige Testamente: Hier erklärt der Staat in§ 2247 BGB deutlich: „Der Erblasser kann ein Testament durch eine eigenhändig geschriebene und unterschriebene Erklärung errichten.“
Eine weitere Ausnahmen sind höchstpersönliche Willenserklärungen, die nach deutschem Recht eigenhändig und schriftlich erfolgen müssen. Die Eheschließung, die Anerkennung der Vaterschaft, die Annahme einer Erbschaft oder eine Patientenverfügung sind höchstpersönliche Willenserklärungen, die nicht digital signiert werden können.
Digitale Signaturen: Einsatzmöglichkeiten im Unternehmen
In den folgenden 4 Bereichen können Unternehmen digitale Unterschriften nutzen, um effizient und schnell Verträge und Dokumente zu unterschreiben:
- HR-Abteilung: Arbeitsverträge und ihr Inhalt können rechtssicher digital unterzeichnet werden. Das beschleunigt Onboarding-Prozesse erheblich.
- Vertragswesen: Vom Lieferantenvertrag bis hin zu Kundenvereinbarungen sind digitale Signaturen eine effiziente Lösung.
- Steuern, Finanzen und Verwaltung: Behörden und der Staat, beispielsweise das Finanzamt und Gemeinden nutzen elektronische Signaturen zunehmend für digitale Akten und Anträge.
- Finanzen und Versicherungen: Genehmigungen oder Policen lassen sich durch digitale Unterschriften automatisieren und absichern.
3 Tipps zur effizienten Implementierung im Unternehmen
- Nutzen Sie branchenspezifische Tools wie Adobe Sign, DocuSign oder die „sign-me„-Lösung der D-Trust GmbH. Diese zertifizierten Softwarelösungen gewährleisten die notwendige Rechtsgültigkeit. Sie ermöglichen eine nahtlose Integration in bestehende Arbeitsprozesse.
- Um Fehler oder eine ineffiziente Nutzung zu vermeiden, ist die proaktive und an Zielen orientierte Schulung der Belegschaft im Umgang mit elektronischen Signaturen ausschlaggebend. Fokus von Schulungen sollte es sein, elektronische Signaturen korrekt einzusetzen und Sicherheitsrisiken zu minimieren.
- Abhängig von Branche und Anforderungen ist es wichtig, sicherzustellen, dass Sie die richtigen Signaturarten verwenden.

